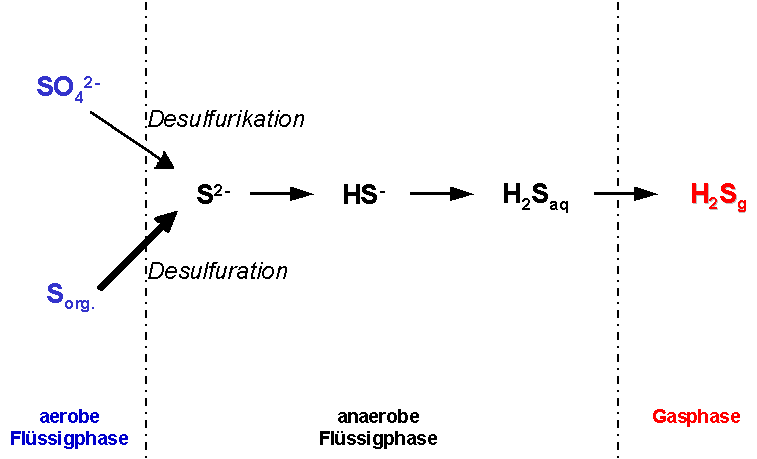

|
Ursachen |
In erster Linie sind es organische Schwefelverbindungen aus Harn und Fäkalien sowie die Eiweise aus Lebensmittelresten,Schlachthofabfällen, Tierhäuten, Waschmitteln, Tenside oder Kosmetika die in den Abfällen und Abwässern unserer Zivilisation die Grundlage für die Bildung von Schwefelwasserstoff verantwortlich sind. Der bekannte Stinkbombengeruch nach faulen Eiern ist H2S. In Kombination mit anderen geruchsverursachenden Stoffen geht dieser H2S-spezifische Geruch aber verloren und verändert den Abwassergeruch zu einen ekligen Gestank.
Die größten Schwefellieferanten für die Bildung von Schwefelwasserstoff:
|
Bier |
160 mg S/kg |
|
Molke |
250 mg S/kg |
|
Kartoffeln |
340 mg S/kg |
|
Zwiebeln |
510 mg S/kg |
|
Kaffee, instant |
600 mg S/kg |
|
Mais |
800 mg S/kg |
|
Reis |
1000 mg S/kg |
|
Fisch |
2300 mg S/kg |
|
Hefe |
3000 mg S/kg |
Wie die unterste Auflistung zeigt sind die Desulfurikanten sehr resistent. Bei Sauerstoffmangel und steigenden Temperaturen sind sie sehr effektiv. Gerade in den Sommermonaten und in den wärmeren Regionen der Welt wenn Sauerstoff schnell verbraucht ist und durch die höheren Temperaturen auch schlecht im Wasser löslich ist, sind Sie verantwortlich für die Produktion des giftigen und aggressiven Schwefelwasserstoffs. Im nebenstehenden Fließschema wird gezeigt wie aus den Schwefellieferanten im Wasser in mehren Stufen Schwefelwasserstoff in der Gasphase entsteht.
Fälschlicherweise wird immer angenommen, daß
gelöstes Sulfat den größten Anteil bei der Sulfidbildung hat. Es sind aber
hauptsächlich die Eiweise und Hefebakterien der oben aufgeführten Schwefellieferanten
die den Schwefel für das Sulfid (S 2- )liefern. Das Aufbrechen des
Sulfats liefert ein Schwefel und vier Sauerstoffatome. Das findet durch z. Beispiel
methanbildende Bakterien nur in Ausnahmefällen statt, wenn diese Bakterien
keine anderen leichter abbaubare Schwefelverbindungen vorfinden. 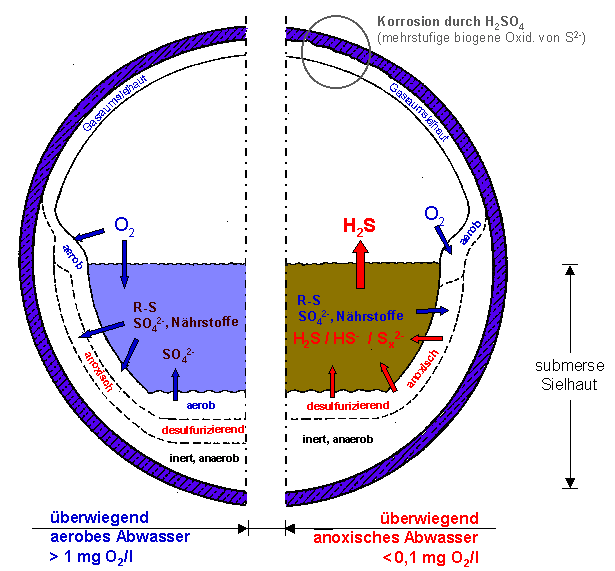 Zur
Information: der Bedarf an Schwefel bei methanbildenden Bakterien ist genauso
hoch wie der Bedarf an Phosphor und meist ist daher Phosphat dann der limitierende
Faktor. Sollte doch das Sulfat von diesen Bakterien "aufgebrochen"
werden bilden sie aber dann kein Sulfid sondern binden den Schwefel in
ihren Zellen. Erst nach dem Absterben der methanbildenden Bakterien kann dieser
Schwefel in Sulfid umgewandelt werden. So kann in einer Biogasanlage nach
über zwei Wochen der gesamte Vorrat organischer Schwefelverbindungen durch die
Methanbakterien aufgebraucht sein und erst dann setzt die Aufspaltung des Sulfats
ein. Das mit Eisen gebildete Eisensulfid
(FeS) bleibt davon unberührt.
Zur
Information: der Bedarf an Schwefel bei methanbildenden Bakterien ist genauso
hoch wie der Bedarf an Phosphor und meist ist daher Phosphat dann der limitierende
Faktor. Sollte doch das Sulfat von diesen Bakterien "aufgebrochen"
werden bilden sie aber dann kein Sulfid sondern binden den Schwefel in
ihren Zellen. Erst nach dem Absterben der methanbildenden Bakterien kann dieser
Schwefel in Sulfid umgewandelt werden. So kann in einer Biogasanlage nach
über zwei Wochen der gesamte Vorrat organischer Schwefelverbindungen durch die
Methanbakterien aufgebraucht sein und erst dann setzt die Aufspaltung des Sulfats
ein. Das mit Eisen gebildete Eisensulfid
(FeS) bleibt davon unberührt.
Um das deutlich zu machen, betrachte man einmal die Inhaltsstoffe einer Mineralwasserflasche. Sulfatanteile von 100 bis 1300 mg/l sind keine Seltenheit und doch ist auch nach Monaten nach dem Öffnen auch ohne Kohlensäure kein Schwefelwasserstoff messbar. Das bedeutet, daß die Umwandlung von gelösten Sulfat im Kanalsystem nur einen sehr geringen Einfluß auf die Schwefelwasserstoffbildung hat, da immer wieder neue leichter abbaubare Schwefelverbindungen an die Sielhaut gespült werden wo hauptsächlich diese Prozesse statt finden. Nur bei Biogasanlagen können unter bestimmten Umständen Teilmengen vom Sulfat stammen. Es ist auch feststellbar, daß es in Kanalsysteme mit anaerob Verhältnissen erst zu extremen Schwefelwasserstoffbildung kommt wenn Einleiter wie Brauereien (Hefe), Schlachthöfe (Eiweis), Lebensmittelindustrie und zeitweise speziell im Herbst Weinbau vorhanden sind
Eigenschaften der Desulfurikanten